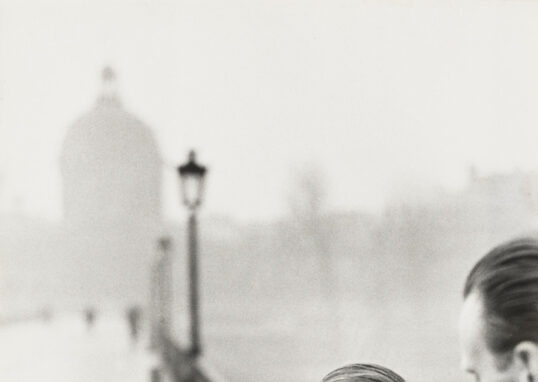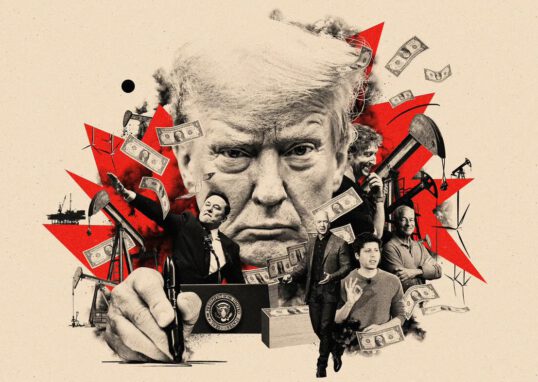Zwischen Schutz und Sprache:Warum Frauenrechte, Identität und Debattenkultur kein Widerspruch sein dürfen.
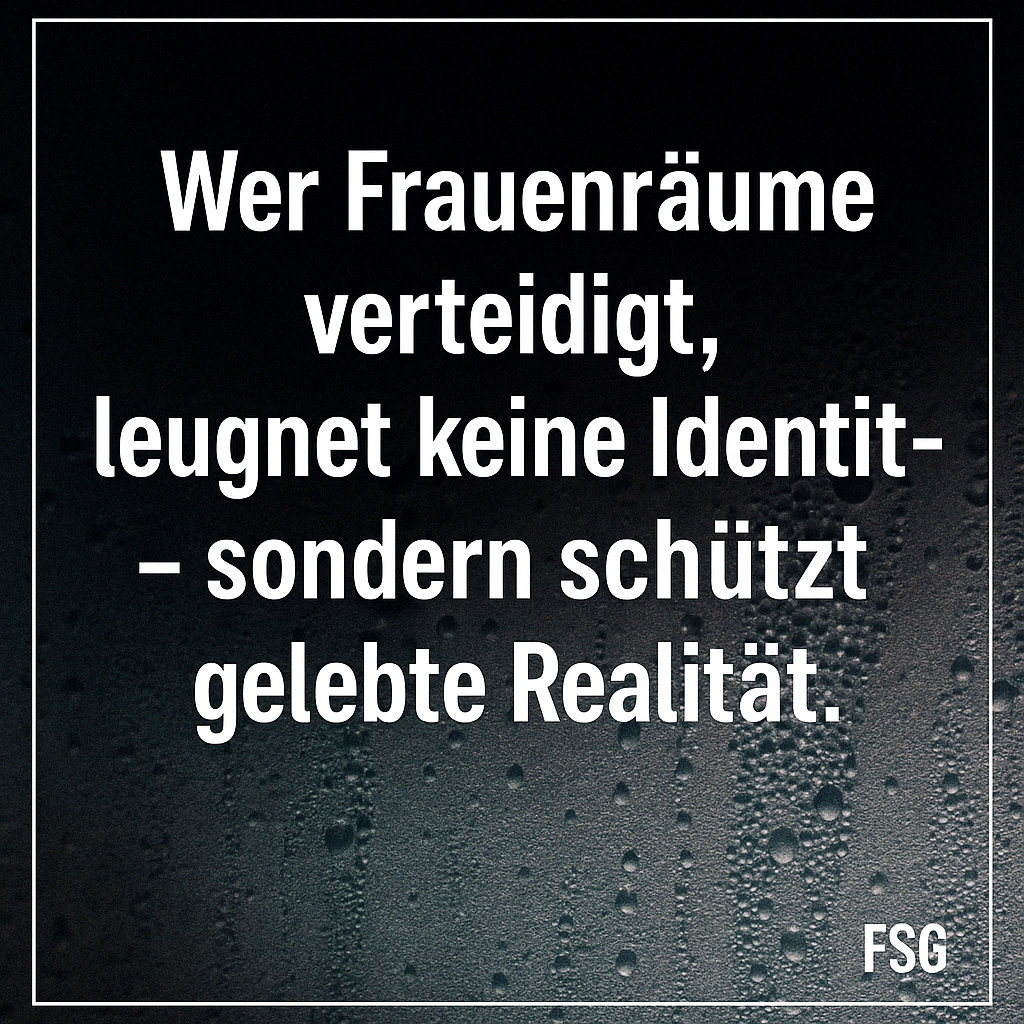
Essay: Differenz, Debatte und Frauenrechte
Francesco Garita
Nach einem polarisierenden Post zum britischen Urteil über die Definition von „Frau“ sah ich mich mit einer Welle von Kritik, Missverständnissen und auch bewussten Fehlinterpretationen konfrontiert.
Deshalb habe ich mich entschieden, meine Perspektive ausführlich und differenziert darzustellen – auch, um jenen eine Antwort zu geben, die nicht nur urteilen, sondern verstehen wollen.
Es geht um Frauenrechte. Um Sprache. Um Identität.
Und vor allem: Um den Zustand unserer Debattenkultur.
Wer es ernst meint mit Differenz, sollte nicht jedes Wort als Feindbild lesen.
Alles begann mit einem Urteil: Der britische Supreme Court entschied, dass im Gleichstellungsgesetz das Wort „Frau“ auf das biologische Geschlecht bezogen ist – nicht auf das empfundene. Ich habe dazu einen Post geschrieben. Er war zugespitzt, ja – aber nicht verachtend. Die Formulierung „heute Mann, morgen Frau, übermorgen Fuchs oder Huhn“ war eine bewusst überspitzte Ironie – eine satirische Zuspitzung, wie man sie in der politischen Debatte kennt. Kein Vergleich, keine Verächtlichmachung – sondern ein pointierter Ausdruck dafür, wie beliebig Geschlechtsidentität in Teilen der Debatte inzwischen definiert werden soll. Gerade Übertreibung hilft manchmal, Mechanismen sichtbar zu machen. Dass manche daraus eine Verächtlichmachung von Transpersonen konstruierten, überrascht mich nicht – aber es war weder so gemeint, noch trifft es den Kern dessen, was ich ausdrücken wollte. Der Rest war ein digitaler Flächenbrand.
Was als Impuls zur Debatte gedacht war, wurde zur Projektionsfläche für Wut. Es hagelte Kommentare, Unterstellungen, Etiketten. Ich sei menschenfeindlich, reaktionär, rückständig. Dabei ging es mir nicht um Ausgrenzung – sondern um Schutzräume, um das Spannungsverhältnis von individueller Freiheit und gemeinschaftlicher Sicherheit. Und vor allem: um die Art, wie wir miteinander reden. Oder besser gesagt: wie wir es nicht mehr tun.
Ich habe erlebt, was passiert, wenn aus Meinungsfreiheit die Erwartung auf Zustimmung wird. Wenn das bloße Hinterfragen schon als Angriff gelesen wird. Wenn selbst jene, die Differenzierung fordern, mit moralischer Eindeutigkeit antworten. Wenn sich ein Meinungsklima formt, in dem nicht mehr gefragt wird: Was meinst du? Sondern: Bist du für uns – oder gegen uns?
Ich bin nicht der Erste, dem das passiert. Die britische Philosophin Kathleen Stock, Professorin an der University of Sussex, äußerte sich 2021 zur Geschlechtsidentität – mit Sachlichkeit, mit Maß. Sie vertrat die Auffassung, dass das biologische Geschlecht nicht veränderbar sei. Nach Protesten, Anfeindungen und massivem sozialen Druck trat sie schließlich zurück. Die Universität verteidigte ihre Wissenschaftsfreiheit, doch der Druck war stärker. Ihr Fall wurde international diskutiert.
Ein weiteres Beispiel ist die Biologin Marie-Luise Vollbrecht, die 2022 an der Humboldt-Universität einen Vortrag über die biologischen Grundlagen von Geschlecht halten wollte. Der Titel: „Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht“. Nach angekündigten Protesten wurde der Vortrag kurzfristig abgesagt. Erst nach öffentlicher Debatte und juristischer Auseinandersetzung konnte sie ihn später nachholen. Auch sie wurde Ziel von massiven Angriffen und öffentlichem Druck.
Und schließlich Inge Bell, ehemalige stellvertretende Vorsitzende von Terre des Femmes. Sie war Mitverfasserin eines Positionspapiers, das sich für Frauenrechte und gleichzeitig für respektvolle Debatten über Geschlecht aussprach. Auch dieses Papier wurde nach öffentlichem Druck zurückgezogen. Bell nannte dies eine Kapitulation vor ideologisch aufgeladenem Aktivismus. Sie warnte davor, dass der Schutz von Frauenräumen zunehmend untergraben werde.
In allen drei Fällen zeigt sich: Wer wissenschaftlich begründete, differenzierte Positionen vertritt, riskiert heute nicht nur Widerspruch – sondern Rufschädigung, soziale Ächtung, Rücktritt oder Ausschluss. Ich kann nur ansatzweise erahnen, was diese Menschen durchgemacht haben – aber sie stehen beispielhaft für eine Debattenkultur, die ihre Offenheit zu verlieren droht.
Wir leben in Zeiten, in denen sich viele Konflikte auf symbolische Stellvertreter-Schlachten verlagert haben. Es geht nicht mehr darum, ein Problem zu verstehen. Es geht darum, Haltung zu demonstrieren. Das eigene Lager zu bestätigen. Die anderen zu diskreditieren. Die Debatte über Geschlecht, Recht und Selbstwahrnehmung ist da nur ein besonders aufgeladener Schauplatz – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Dabei geht es – aus meiner Sicht – um eine sehr grundsätzliche Frage: Wie leben wir als Gesellschaft mit Differenz? Wie verhandeln wir zwischen subjektivem Empfinden und objektivem Schutz? Was darf Recht leisten – und was darf es nicht aufgeben? In keiner menschlichen Gemeinschaft kann der individuelle Anspruch dauerhaft über dem kollektiven Schutz stehen. Das Überleben der Gemeinschaft war immer der Maßstab.
Natürlich darf das kein Freifahrtschein für Repression sein. In einem Rechtsstaat ist der Schutz der Gemeinschaft an Grundrechte gebunden. Was autoritäre Systeme als „Gemeinwohl“ deklarieren, muss in einer Demokratie mit Menschenwürde, Gleichheit und Pluralität vereinbar bleiben. Wer auf Kollektivschutz pocht, muss sich gleichzeitig gegen Diskriminierung stellen. Aber ebenso darf das Recht nicht beliebig werden. Es braucht Kategorien, damit Schutz überhaupt möglich ist. Das gilt für Frauenräume wie für viele andere Schutzrechte auch.
Ich weiß, wie sich Ausgrenzung anfühlt. Ich bin in den 60ern geboren, in den 70ern groß geworden – als jemand mit anderer Herkunft, anderer Staatsangehörigkeit. Ich habe institutionellen Rassismus erlebt, Ausgrenzung in Schule, Beruf, Studium – und auch in meiner Partei, die sich „links“ nennt. Ich habe erfahren, wie es ist, wenn Rechte nicht für alle gelten. Und ich weiß, dass sie dann am stärksten sind, wenn sie sich auf reale Grundlagen stützen, nicht auf beliebige Deutung.
Ich bin und habe meinen Töchtern und Stieftöchtern mit Rat und Tat beigestanden – in einer Welt, die Mädchen und Frauen oft strukturell benachteiligt. Ich wollte und will ihnen helfen, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und ein starkes Gespür für Gerechtigkeit zu entwickeln. Ich wollte, dass sie ihre Stimme erheben – auch wenn sie unbequem ist. Ich wollte, dass sie sich nicht kleiner machen, um anderen zu gefallen. Und ich wollte, dass sie erkennen, dass Würde nicht verhandelbar ist – weder im Privaten noch im Öffentlichen.
Der Einsatz für Frauenrechte ist für mich deshalb kein theoretisches Prinzip. Er ist Teil meiner Biografie, meiner Erziehungserfahrung, meines Verständnisses von Verantwortung – und meines politischen Denkens. Wer Gleichberechtigung ernst nimmt, muss sie aktiv verteidigen. Auch – oder gerade – dann, wenn es unbequem wird.
Ich weiß, dass Transmenschen Diskriminierung erleben. Ich leugne ihre Verletzlichkeit nicht. Und ich will auch keine Gewalt gegen sie stillschweigend hinnehmen. Aber ich will nicht schweigen, wenn aus berechtigtem Schutzbedürfnis ein Denkverbot wird. Wenn Frauen, die Schutzräume einfordern, als transfeindlich diffamiert werden. Wenn jeder Einwand als Angriff gilt.
Ich habe mit Interesse den Text von Kerstin Schuster gelesen, einer Transfrau, die seit 20 Jahren in ihrer Identität lebt. Sie schreibt nicht vom Kampf – sondern von Selbstverantwortung. Sie beschreibt, wie sie gelernt hat, sich nicht als Opfer zu definieren. Wie sie Stärke gefunden hat, jenseits von Zuschreibungen. Und sie macht Frauen Mut – native wie trans –, ihre Kraft zu entdecken. Ihre Haltung hat mich beeindruckt. Sie zeigt: Es geht auch anders.
Was mir fehlt, ist ein echter Diskurs. Nicht die Schlacht der Narrative, sondern das Ringen um ein gemeinsames Bild. Ich bin nicht gegen Transmenschen. Ich bin gegen moralische Erpressung. Ich bin gegen die Idee, dass Meinungsfreiheit nur dann zählt, wenn sie die richtige Meinung trifft. Ich bin gegen die Art und Weise, wie sich manche Lager radikalisieren – links wie rechts. Ich bin für eine Gesellschaft, die Differenz aushält. Die sagt: Du siehst es anders – und bleibst trotzdem mein Gegenüber.
Ich schreibe weiter, weil wir Räume brauchen, in denen Differenz nicht sofort mit Ausgrenzung gleichgesetzt wird. Ich möchte nicht Teil eines Lagers sein, das andere angreift – sondern Teil einer Öffentlichkeit, die Differenz erträgt. Es braucht Debatten, die nicht reflexhaft in moralische Urteile kippen, sondern Raum für Widerspruch und Zweifel lassen. Ich werde mich nicht auf jede hitzige Auseinandersetzung einlassen – aber ich werde Haltung zeigen. Gerade jetzt. Denn nur eine offene, respektvolle Debatte kann zugleich Frauenrechte, Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Zusammenhalt schützen.
Autor
garita@garita.de
Ähnliche Beiträge

Essay Trump
Die Streitschrift analysiert den systematischen Angriff auf die Demokratie...
Alles lesen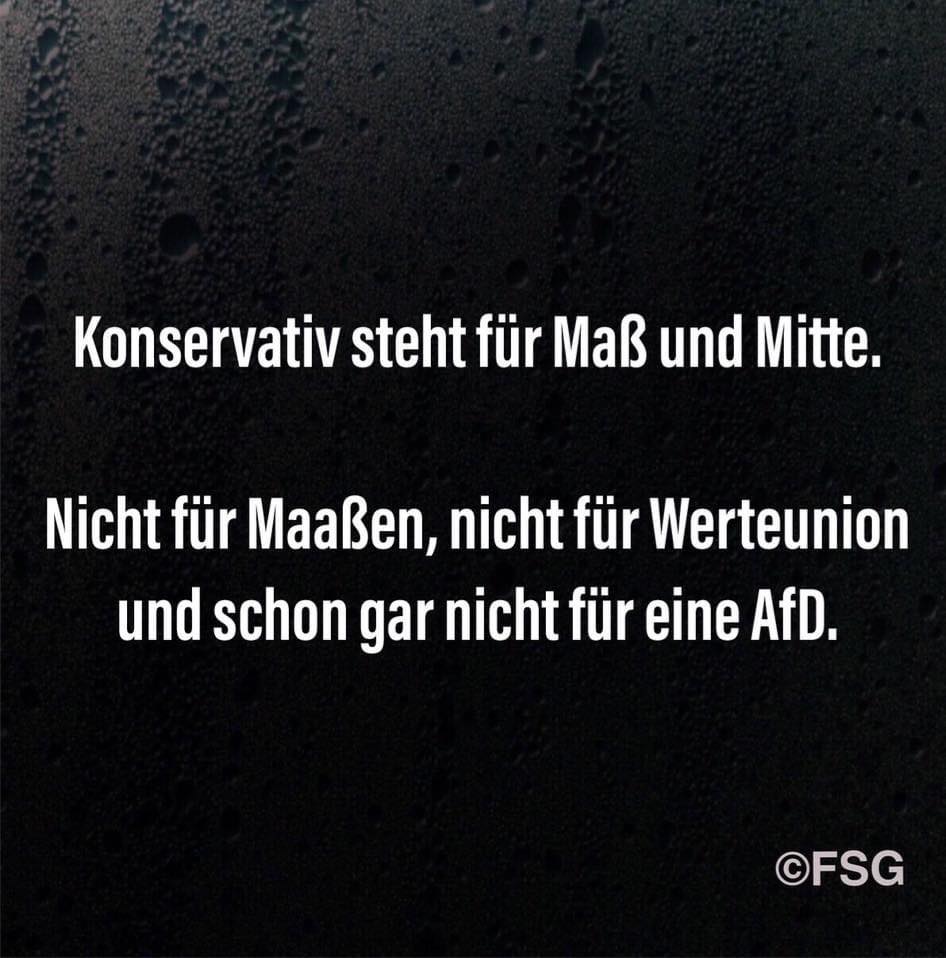
Maß und Mitte in der Politik: Ein zeitloses Prinzip für eine ausgewogene Zukunft
In Zeiten starker politischer Strömungen und der Suche...
Alles lesen
Die nächste Revolution ist die eines neuen Lebenstiles!!!!
Was man als politisch denkender Mensch ablehnt, ist offenkundig dann...
Alles lesen